Immanuel Kant, der vor 300 Jahren, am 22.04.1724, in Königsberg in Ostpreußen geboren wurde, gilt als der einflussreichste Denker der deutschen, der Aufklärung überhaupt, einer der einflussreichsten Philosophen bis heute. Kant steht wie kein zweiter Philosoph für das Projekt der Aufklärung. Er befreite das Denken der Menschen unabhängig von ihrer Herkunft von den Ansprüchen einer „gottgewollten“ feudalen Ordnung und der Dominanz religiöser Dogmatik. Die Aufklärung Immanuel Kants war der Durchbruch zu rationaler Individualität und Verantwortlichkeit jedes Menschen. Überkommene Autoritäten und Traditionen wurden in Frage gestellt, Schwärmerei und Irrationalität abgelehnt. Nur wer sein Denken mitteilen, vergleichen und nötigenfalls revidieren kann, konstituiert tatsächliche Freiheit. Wer heute in den westlichen Gesellschaften für individuelle Menschenrechte auf Religions-, Presse- und Meinungsfreiheit sowie für sexuelle Selbstbestimmung eintritt, steht auf den Schultern, den Denksystemen Immanuel Kants.
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. … Sapere aude! Habe Muth dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“ Formulierte Kant 1784 im Aufsatz „Was ist Aufklärung?“
Ein neues Verständnis einer methodisch gewonnenen Objektivität des Urteils, ermöglicht durch freie Individualität, breitete sich über die Denker der Aufklärung in den Gesellschaften aus. Es gelten objektive Methoden der Beurteilung, Erörterung, freie Zustimmung, eine alle Schichten und Stände übergreifende Verständigung. „…, dann verschwindet der Dunst, und ich erblicke die Wahrheit.“[1]
Die aufkommenden bürgerlichen Freiheiten entwickeln sich aus einem „Geist kultureller Erweckung“[2], entfesseln die Leistungsfähigkeit der Menschen auch im Wirtschaftlichen (Industrielle Revolution), auch bis hinein in die Philosophie: „selbst das Denken kann in diesem Zeitalter der Arbeitsteilung ein besonderer Beruf werden. … Die Früchte des Scharfsinns werden auf den Markt gebracht und die Menschen bezahlen bereitwillig für alles, was zu ihrer Unterweisung oder ihrem Vergnügen dient.“[3]
Die Naturwissenschaften – dasjenige, was wir nach Kant von der Natur und uns überhaupt zu erkennen in der Lage sind – begründeten den analytischen Geist der modernen Welt, waren der Garant der Freiheit. Innerhalb dieses Geistes bewegen wir uns heute in den westlichen Gesellschaften weiterhin. „Follow the science“ gilt als Kampfbegriff globaler Klimaaktivisten, die annehmen, mit naturwissenschaftlichen Studienergebnissen unleugbare Vernunftwahrheiten auf ihrer Seite zu haben. Die Ausdehnung der naturwissenschaftlichen Denkweisen auch auf Moral, Recht, ökonomische Theorie, also auf die Gesellschaft insgesamt, bildete ein wichtiges Momentum der Aufklärung.
Bis heute gilt in den westlichen Gesellschaften die Grundannahme der rationalen Auflös-barkeit aller menschlichen Herausforderungen. Wenn man sich nur hinreichend vernünftig den Problemen annähere und sie nach Maßgabe rationaler Moralkategorien bewerte und bewege, müsse sich alles zum Guten auflösen.
Nicht zuletzt die Erfahrungen der Katastrophen des 20. Jahrhunderts mit seinen zwei vernichtenden Weltkriegen, dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus haben die Grundannahme der Entwicklung der Menschheit aus Vernunfterwägungen hin zu vernünftigen Zielen, grundlegend erschüttert.[4] Es wird vielfach davon ausgegangen, dass der naturwissenschaftlich unterlegte Rationalismus der Aufklärung mit in die Katastrophen geführt habe.[5]
Auch haben die katastrophischen Erfahrungen demgegenüber Phasen rationaler Begründung kollektiven menschlichen Handelns nach sich gezogen, ja geradezu erzwungen (Vereinte Nationen, Europäische Union, Abrüstungsverträge u.v.a.m.). Ganz im Sinne eines „existentiellen Imperativs“ wie ihn Friedrich Nietzsche auf der Grundlage der Handlungen eines identischen menschlichen Wesenskerns im 19. Jahrhundert postulierte. Katastrophisches Handeln kehrt nicht wieder, weil der Mensch erfahren hat, dass er sonst seine Existenzgrundlage vernichtet.
Was ist, wenn sich diese Erfahrungen verflüchtigen oder schlicht in manchen Regionen der Welt nicht vorhanden sind? Die Moralprinzipien des kategorischen Imperativs beschreiben nur eine sehr eingeschränkte, temporäre Möglichkeit menschlichen Handelns.
Die rationale Weltbetrachtung des Westens ist, auch im Westen, zu einer Chimäre, einer Illusion geworden (siehe Donald Trump, siehe den Eroberungskrieg Russlands in der Ukraine, siehe die Eroberungsgelüste Chinas gegen das abtrünnige Taiwan, siehe den Terror des politischen Islam). In den westlichen Gesellschaften verengen sich die Meinungskorridore durch totalitär anmutenden Moralgebote einer postmodernen, Oberschicht. Die Meinungs-freiheit als Grundlage der Aufklärung, von rationaler Individualität und Verantwortlichkeit, schwindet – auch im Westen.
Wir sind über die Aufklärung hinaus. Ist die Aufklärung, die eigentliche Gottheit des bürgerlichen Zeitalters, tot? Brauchen wir eine neue – Aufklärung?
Einerseits habe der Mensch, so Immanuel Kant, das Bedürfnis etwas Absolutes und Unendliches als einen Urgrund zu denken. Anderseits ist dieses Absolute, so Kant, mit den Bordmitteln des menschlichen Erkenntnisvermögens nicht zu erkennen, das „Ding an sich“ verbleibt trotz hochmoderner Messinstrumente im Dunkeln. Die Gegenstände des Lebens richten sich nach unserem (eingeschränkten) Erkenntnisvermögen, danach wie wir zu Denken in der Lage sind.[6] Der graue (oder bunte) Zwischenraum, dieser Abstand zwischen Erkanntem und nicht Erkennbaren des eigenen Seins, ist der Bereich der Intuition, der Mystik, auch der Epoche der Romantik, die historisch auf die Aufklärung folgte. Die romantische Weltanschauung entwickelte einen ganz eigenen Bereich menschlicher Freiheit, der über die reine Rationalität hinausging.
Es sollte – um den Bezug zu menschlichen Lebenswelten zu erhalten und zu behalten – nicht mehr nur heißen: Habe den Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Eine neue Aufklärung sollte dazu auffordern: Habe den Mut, dich deiner Intuition zu bedienen.[7] Die reine Rationalität führt – im Nur-Gedachten – zu weit, über unsere Möglichkeiten hinaus. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass es so etwas, auch eine interessenlose Vernunft, überhaupt geben kann. Der menschliche Verstand muss den Menschen immer wieder als irrationales, intuitives Wesen begreifen, um die menschliche Intuition, das Erfahrungsempfinden, scharf zu stellen.[8] Er erkennt sich dann als etwas Begrenztes und Endliches, etwas boden-ständig Gebogenes. Während die Ratio dazu tendiert, maßlos über sich selbst hinauszugehen, sollten wir unsere Begrenzungen, unsere Bodenständigkeit, unser Selbst lieben und leben lernen und sie pflegen: als Familienmenschen, als Kulturbürger im nationalen Kontext, als religiöse Menschen.
[1] Spalding, Johann Joachim, Die Bestimmung des Menschen, Leipzig 1774, S. 29
[2] Irrlitz, Gerd, Kant Handbuch, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart, Weimar, 2010, S. 22
[3] Ferguson, Adam, Abhandlung über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Jena, 1923, S. 258
[4] Friedrich Nietzsche bezeichnete die Aufklärung als Epoche, die die bloße Vernunft zur Herrschaft zu bringen suche, keine Mythen mehr kenne und sich insgesamt als misslungenes Unterfangen lesen lasse, das Dasein „als begreiflich und damit als gerechtfertigt erscheinen zu machen.“ Der dazu gehörige Menschentyp sei der des „theoretischen“ Menschen, der an eine Correctur der Welt durch das Wissen, an ein durch Wissenschaft geleitetes Leben “ glaube. Nietzsche, Friedrich, Sämtliche Werke. Kritische Gesamtausgabe in 15 Bd., Hrsg. V.G. Colli u. Montinari, München, 1986, S. 99, 115
[5] In der „Dialektik der Aufklärung“ aus dem Jahr 1944 unterzogen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno den Vernunftbegriff der Aufklärung einer radikalen Kritik. Sie formulier-ten die These, dass sich in der Menschheitsgeschichte eine instrumentelle Ver-nunft durchgesetzt habe, die sich als Herrschaft über die äußere und innere Natur und schließ-lich in der institutionalisierten Herrschaft von Menschen über Menschen verfestigte. Ausge-hend von diesem „Herrschaftscharakter“ der Vernunft beobachteten Horkheimer und Adorno einen Aufschwung der Mythologie, die „Rückkehr der aufgeklärten Zivilisation zur Barbarei in der Wirklichkeit“. In: Horkheimer, Max, Gesammelte Schriften, Bd. 5, Fischer, Frankfurt a.M., 1987, S. 6
[6] Die Grundstrukturen unseres Denkens und Erkennens sind zugleich die Grundstrukturen der für uns erkennbaren Realität.
[7] Friedrich Nietzsche spricht vom „intuitiven Menschen“, der anders als der „vernünftige Mensch … nur das zum Schein und zur Schönheit verstellte Leben als real nimmt.“ Nietzsche, Friedrich, Sämtliche Werke. Kritische Gesamtausgabe in 15 Bd., Hrsg. V.G. Colli u. Montinari, München, 1986, S. 889
[8] Sohns, Achim, Philosophische Widerworte, 2022, S. 65 – 69
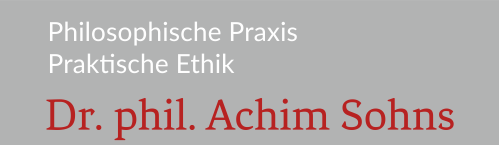
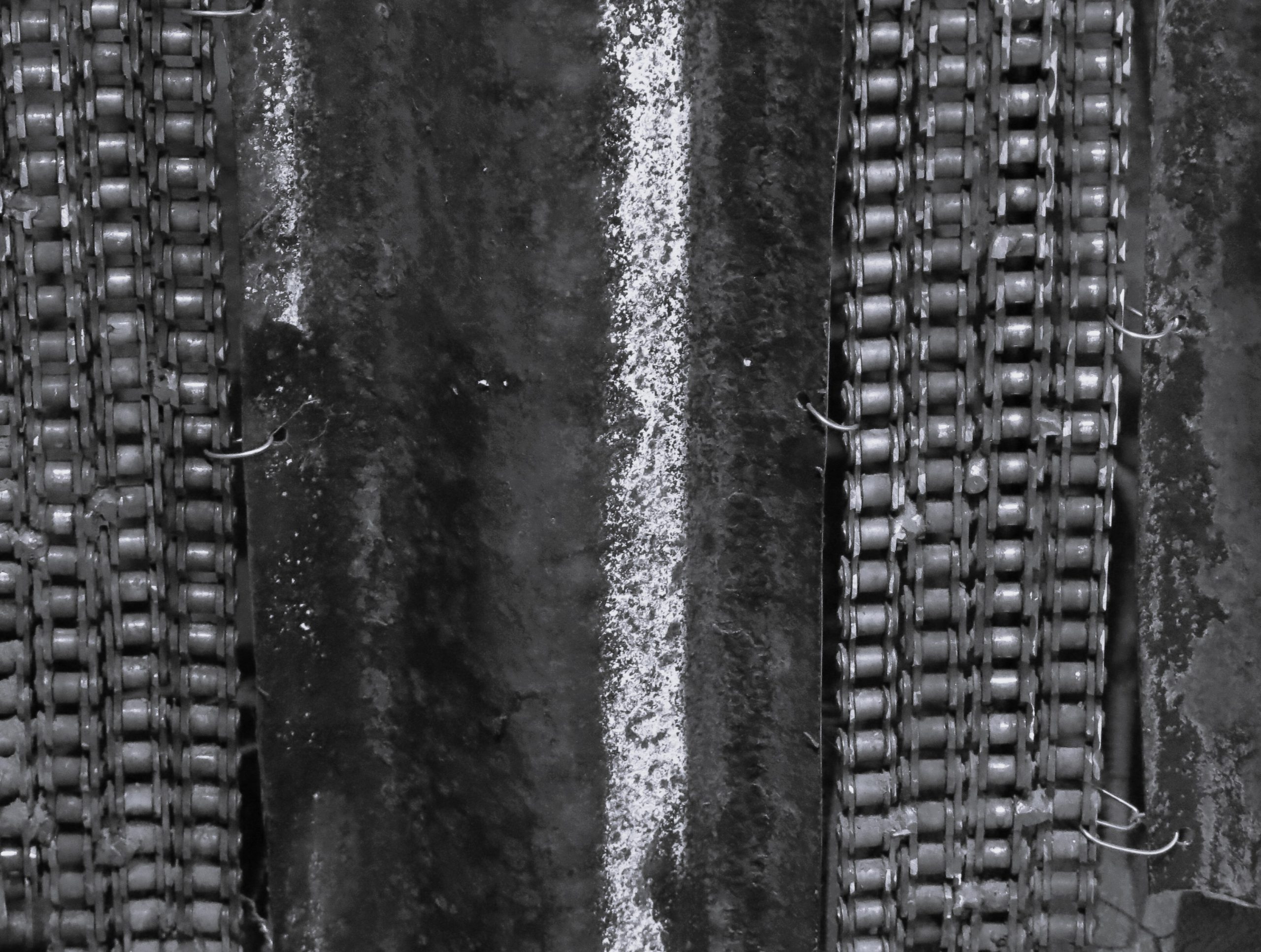 Aufklärung 2024
Aufklärung 2024