„Die Existenz, derer wir am gewissesten sind und die wir am besten kennen, ist unbestreitbar die unsere. Denn von allen übrigen Gegenständen haben wir Begriffe, die sich als äußerliche und oberflächliche bezeichnen lassen, während wir uns selbst von innen her und tiefgehend wahrnehmen.“[1]
Frühling steht in einer möglichen Symphonie der Jahreszeiten sinnbildlich für Aufbruch, Beginn von etwas Neuem, von neuem Leben in einer wiedererwachenden Natur.[2] Die Dunkelheit des Winters zieht sich zurück. Der Frühling steht in der Welt der Menschen für die Illusion der Unendlichkeit. Das Endliche wird verdrängt. Mehr Licht, Lichtung, frische Leichtigkeit greift um sich. Auf einen Schlag und über Wochen verändert sich die Gegenwart, der graue Alltag gewinnt an natürlicher heller Tiefe, vielerlei Farbe und Bedeutung – momenthaftes Werden, das andauert, neuer Mut.
Der Frühling bringt Knospen und helles Grün in Hülle und Fülle, die später zu vollem Leben, zu Blüten, Halmen und satten Blättern ausreifen. In unserer Intuition steht er für die erste Zeit im neuen Jahr, erst nur und länger schon herbei gesehnt, dann wirklich. Im Aufbruch des Frühlings spielt neu eine schon einmal, oft, vergangene Melodie. Wir wandern durch junges durchscheinendes Grün in unseren Wäldern und Parks. Heraufstrebende Bilder, Gedanken für neue Pläne schreiten parallel und warten auf ihr Erleben. Sinn und Freude machen sich breit, alles drängt ins Offene und ans Licht, sucht Kontakt, kreativen Austausch, neue Befruchtung. Leben ist wieder draußen. Der Frühling lässt nicht ahnen, ob ein Sommer vielleicht zu heiß werden könnte …
Im Angesicht des Frühlings gilt es die Perspektiven zu weiten. Wir erfahren intuitiv im inneren Erleben, in „Frühlingsgefühlen“, dass wir nur aus und im Austausch mit der Natur und anderen Menschen sind und sein können – also mit Kräften, die jenseits unseres eigenen Wollens wirken. Wir wollen, können uns nun in sie, die Natur und die Menschen, hineinversetzen. Jetzt werden erstarrte Gefühle, Gedanken und Sinneseindrücke als Ganzes im Inneren zuerst flüchtig und rücken wieder zusammen – in mir als körperlichem und geistigem, äußerem und innerem Selbst. Die Mannigfaltigkeit der Bewusstseinsinhalte wird intuitiv als Zusammenhang gesehen oder gefühlt, in dem die Zustände miteinander verschmelzen, ähnlich wie die Töne in der Melodie, in einer Symphonie. Den Rest können wir weg lassen.
Bei der physikalischen Betrachtung wird jeder Ton notwendig als unabhängiges Ereignis erfasst. Im inneren Erleben der Melodie formt sich hingegen ein kontinuierlicher Strom, in dem vergangene Töne mit den gegenwärtigen (und den erwarteten, wenn wir die Melodie schon kennen) im Bewusstsein zusammenfließen. In unserem intuitiven, nicht dem intellektuellem, Erleben sind wir Teil des Stroms der Zeit, in dem sich das Leben im Frühling entfaltet. Wir sind Frühlings-Melodien mit all ihrem Werden.
„… seine [Bewusstsein] Empfindungen würden sich dynamisch miteinander summieren und sich untereinander organisch strukturieren, wie es die aufeinanderfolgenden Noten einer Melodie tun, von der wir uns wiegen lassen. Kurz, die reine Dauer[3] könnte sehr gut lediglich ein Nacheinander qualitativer Veränderungen sein, die miteinander verschmelzen und sich durchdringen, ohne scharfe Konturen, ohne die geringste Tendenz, einander äußerlich zu werden und ohne die geringste Verwandtschaft mit der Zahl.“[4]
April, dessen Name vom griechischen Wort für „Öffnung“ stammt, öffnet die Haustüren und Fenster und lädt ein, das wunderduftende und sich ausbreitende Grün als Wohnzimmer zu besetzen. Den Naturraum sehen, riechen und hören können, öffnet unsere Wahrnehmung – für das Hier und Jetzt, den intuitiven Augenblick.
Die Frühlingssäfte steigen allenthalben, steigen auch zu Kopf. Es menschelt ungemein. Soll man das alte Liebesgedicht weiterschreiben und vollenden oder eine neue Liebschaft beginnen? Soll man sich kopflos in Abenteuer stürzen, der Unvernunft die langen Zügel lassen, gedankenlos und sorglos der Zukunft entgegen – was im Herbst oder Winter nie zu wagen gewesen wäre. Der Frühling ist die Jahreszeit des intuitiven Leichtsinns. Die Natur fordert den leichten Sinn zu Recht. Wird die Welt denn nicht mit jedem Tag noch schöner?
Der Frühling, auch wenn er neuerdings oft schon im März beginnt, ist der sich wiederholende Beweis für den Aufbruch in einen ständigen Schaffensprozess, der niemals endet. Das Sein ist unbegrenzte Freiheit im Hervorbringen von Formen. Darin leben und erfahren sich die Menschen, hoffentlich. Sie selbst entwickeln sich aus eigenem Antrieb in ihre „Form“.
Ihre Intuition richtet sich im Frühling in besonderer Weise auf ihr je eigenes Selbst. Physisches und Psychisches sind nichts eigenständig Selbständiges. Es gilt vielmehr von vornherein den Zusammenhang von materieller Umgebung des Körpers, von Reizen und Vorgängen im Nervensystem und von bewusster Wahrnehmung zu erkennen. Vielleicht wird man sich mit etwas Glück seines menschlichen Erlebens selber – auch ohne musikalische Fertigkeiten – als Melodie bewusst. Im Erleben spielen die vorhergehenden Töne eine Rolle für die gegenwärtige Wahrnehmung eines jeden neuen Tons.
„Wenn wir eine Melodie hören, so haben wir den reinsten Eindruck von Nacheinander, den wir haben können – ein Eindruck, der so weit wie nur irgend möglich von dem der Gleichzeitigkeit entfernt ist -, und doch ist es gerade die Kontinuität der Melodie und die Unmöglichkeit, sie auseinanderzunehmen, die diesen Eindruck auf uns macht.“
Bekannte Verhaltensweisen drohen immer durch Routinen automatisiert zu werden, verlaufen dann tonlos, ungelebt und unbewusst – Winter war viel Stagnation, „Eiszeit“, Unbewusstsein. Mit dem Frühling kehrt mit der schöpferischen Kraft auch die schöpferische Melodie zurück. Das Bewusstsein, unsere Melodie, vielleicht eine neue Symphonie, setzen sich in Bewegung.
„Das Rad an meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon wieder recht lustig, der Schnee tröpfelte emsig vom Dache, die Sperlinge zwitscherten und tummelten sich dazwischen; ich saß auf der Türschwelle und wischte mir den Schlaf aus den Augen; mir war so recht wohl in dem warmen Sonnenscheine. … Es war mir beständig zumute wie sonst immer, wenn der Frühling anfangen sollte, so unruhig und fröhlich, ohne dass ich es wußte, warum, als stünde mir ein großes Glück oder sonst etwas Außerordentliches bevor.“[5]

[1] Bergson, Henri, Philosophie der Dauer, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2013, S. 13
[2] Der Frühling oder Lenz, auch das Frühjahr genannt, ist eine der vier Jahreszeiten und folgt auf den Winter. In den gemäßigten Zonen ist es die Zeit der erwachenden und sprießenden Natur. Im Laufe eines Jahres ändern sich gemessene Tageslänge (als Dauer des lichten Tages) und Tagbogen der Sonne (mit höchstem mittäglichen Sonnenstand) abhängig von der geographischen Breite eines Ortes. Dies führt auf der Erde in mittleren Breiten zu deutlich ausgeprägten Jahreszeiten, die sich auf beiden Hemisphären in jährlichem Turnus wiederholen. Während auf der einen Hemisphäre Herbst ist, ist auf der anderen Frühling; vom Südfrühling der Südhalbkugel wird der Nordfrühling der Nordhalbkugel unterschieden.
Astronomisch beginnt der Frühling mit einer Tag-und-Nacht-Gleiche (auf der Nordhalbkugel am 20./21. März; auf der Südhalbkugel 22./23. September) und endet astronomisch mit der Sommersonnenwende (20./21. Juni auf der Nordhalbkugel). Meteorologisch wird er meist auf Anfang März angesetzt.
[3] „Die reale Dauer ist das, was man von jeher die Zeit genannt hat, aber die Zeit als unteilbar wahrgenommene. Daß die Zeit das Nacheinander impliziert, leugne ich nicht. Daß aber das Nacheinander sich unserem Bewusstsein zuerst als die Unterscheidung eines nebeneinander gereihten „Vorher“ und „Nachher“ präsentiert, das ist es, was ich nicht zugeben kann.“ Bergson, Henri, Philosophie der Dauer, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2013, S. 28.
[4] Bergson, Henri, Philosophie der Dauer, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2013, S. 23.
[5] Eichendorff, Aus dem Leben eines Taugenichts, Leipzig 1928, S. 47, 59
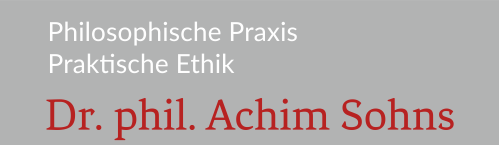
 L'évolution créatrice
L'évolution créatrice