„In der Abgeschiedenheit vom Weltverkehr, in der Einsamkeit eines das Leben ausfüllenden Naturgenusses hört die Zeit auf, ein bestimmendes Moment des Interesses zu sein.“ [1]
Wer wandert, möchte sich durch die gleichbleibende, wiederholende Monotonie der Schritte in einzigartigen Landschaften gegenwärtig fühlen, anwesend ohne Ablenkung, selbst erfahren. Wer wandert, begegnet sich selbst im Anlasslosen. Wanderer haben physische Ziele, aber kein eigentliches Ziel. Das Erleben der Landschaft dient als Passage. Er fängt sie ein, nimmt sie auf, ohne sich ihrer zu bedienen. Sie ist Teil seiner anlasslosen Gegenwärtigkeit.
Es geht dem erfahrenen Wanderer nicht um Leistung. Er führt keinen Wettkampf um Resultate, Zahlen und Zeiten. Er setzt einen Fuß vor den anderen. Es geht ihm um Ausstiege und Lösungen – vom Alltäglichen zu sich selbst. Es geht um einfache Intensität, um Emotion, die sich laufend vertieft. Ja, man kann sagen, Langsamkeit ist das Ziel.
Das Gehen erlaubt es, mit den gewohnten hyperreal gewordenen Reproduktionstechniken zu brechen – eine Erfahrung von Vertrautheit mit sich und der Welt wiederzufinden.
Zu Fuß gehen, wandern, ist ein Moment der Entschleunigung, keine Zeitgleichheit wie im digitalen Space, keine geflogener Hyperschall, 200 Sachen im ICE, Vorbeirauschen von Sachen. Kein Verflüchtigen im World Wide Web. Die neuen Techniken und ihre Omnipräsenz sind der Feind der Entschleunigung. Wandern heißt sich der Geschwindigkeit und ihren digitalen Zwängen mindestens analog zu widersetzen. Jeder Schritt birgt die Erfahrung des tatsächlichen Gewichts der Körper. Digitale Techniken sind das Gegenteil : das irrige Versprechen einer Entkörperlichung, die Illusion der Entlastung vom Körperlichen durch ununterbrochene digitale Verbindung.
Evolutionsbiologisch war das Gehirn zunächst für die Koordinierung der Bewegungen zuständig. Das Denken folgte tausende Jahre später als nur abgeleitete Form der praktischen Hirnfunktionen. Bewegung, Gehen stehen am Anfang. Das Denken schließt sich ihnen an. Beim Wandern kommen beide Seiten des Menschen ursprünglich zusammen.
Unterschiedliche Stile des Wanderns können unterschiedliche Formen der Müdigkeit und Erschöpfung hervorbringen. Wenn man wandert, um bis zum Ende seiner selbst zu gehen, nach Erschöpfung sucht, zu einem wandernden Körper wird, so korrespondiert dem sogar ein bestimmtes Quantum Rausch, eine Überwindung der gedachten Identität im Bewusstsein – die höchste Form des Wanderns.
„Mein Weggefährte und ich – ja, gelegentlich habe ich einen Begleiter – gefallen uns in der Phantasie, wir wären Ritter eines neuen, oder besser: eines sehr alten Ordens: freilich nicht Equites oder Chevaliers, nicht Ritter oder Reiter, sondern Fußläufer, Wanderer – eine denke ich – noch ältere und noch ehrbarere Klasse. Der ritterliche, heroische Geist, der früher den Ritter zu Pferde eigen war, scheint jetzt offenbar den Fußläufern zugefallen zu sein oder setzt sich allmählich in ihnen fest. Was früher der fahrende Ritter war, ist heute der fahrende Wanderer, so etwas wie der vierte Stand.“ [2]
[1] Lorm, Hieronimus, Philosophie der Jahreszeiten, Verlag A. Hofmann & Co, Berlin 1876, S. 247
[2] Thoreau, Henry David, Vom Wandern, Kampa Verlag AG, Zürich, 2022, S. 9 (zuerst erschienen 1862 unter dem Titel „Walking“ in der Zeitschrift Atlantic Monthly)

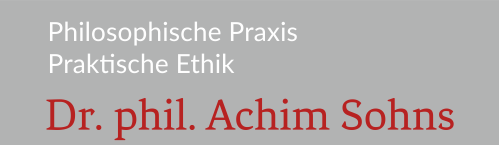
 Wege
Wege