Demokratien weltweit auf dem Rückzug.
Am 9. November 1989 öffnete sich die Berliner Mauer, der Eiserne Vorhang fiel. Der Sieg des Westens, der liberalen Demokratien, auf der Basis freier Markt-wirtschaften, schien unumkehrbar. Francis Fukuyama postulierte gar das „Ende der Geschichte“. Der damalige Impuls scheint heute aufgebraucht. An der Stelle der Hoffnungen auf eine prosperierende demokratische Weltgesellschaft ver-breiten sich Selbstzweifel und Zukunftsängste.
Es kristallisiert sich eine neue multipolare Weltordnung heraus, die durch den Kampf von Staaten um die wirtschaftliche und militärische Vorherrschaft geprägt ist. Die westlichen Demokratien, selbst die USA, die die Kraft einer universellen moralischen Substanz, rationaler Argumente, für sich reklamieren, sind zu Playern unter Vielen geworden. Der neu gewählte US-Präsident Donald Trump erhebt imperialen Anspruch auf Kanada, Grönland und den Panama-Kanal. Deutschlands wichtigster europäischer Partner Frankreich befindet sich in einer Krise und hat fünf Regierungen in zwölf Monaten gesehen. Die Demokratien erwecken den Eindruck, als seien sie auch nach innen in der Defensive. Weltweit nimmt die Zahl „vollständiger Demokratien“ ab. In einer vollständigen Demokratie leben nur 78 % der Weltbevölkerung (entspricht 14,4 % der Länder). Hingegen leben 39,4 % in einer Diktatur (zeit online vom 24.02.2024).[1]
Was aber ist Demokratie?
Nach Aristoteles (384 v. Chr. bis 322 v. Chr.) verwirklicht sich in der Polis (der Gemeinde freier Bürger) das Telos, also die Natur des Menschen. Der Mensch sei ein wesentlich soziales und politisches Lebewesen (zõõn politikon, Politik I, 1, 1253a 1-11). Der Keim dieses Wesens ist die Gemeinschaft. Erst im Verbund mit anderen Individuen kann der Einzelne zur Verwirklichung seiner Bedürfnisse und Ziele gelangen. Zitat:
„Von Natur aus nun gibt es in allen den Trieb nach einer solchen Gemeinschaft. … Denn das ist den Menschen im Gegensatz zu den anderen Lebewesen eigentümlich, dass nur sie über die Wahrnehmung des Guten und des Schlech-ten, des Gerechten und des Ungerechten und anderer solcher Begriffe verfügen. Doch die Gemeinschaft mit solchen Begriffen schafft Haus und Staat.“
Der Staat besteht aus Menschen, die zwar als Gattungswesen und in ihren allgemeinen Handlungsmotiven gleich sind, als Individuen aber sehr verschieden sein können. Neben die prinzipielle gesellschaftliche Gleichheit und Freiheit der in der Polis handelnden Bürger tritt deren Unterschiedlichkeit. Sie bilden eine heterogene Einheit (Politik II, 5, 1261a). Über die zu entscheidenden Fra-gen verhandelten die Bürger einer Polis in einer frühen Form direkter Demo-kratie in der Öffentlichkeit, an einem öffentlichen Ort, in freier Rede.[2] Sodann wurde das Beschlossene in allgemeinverbindliche „Gesetze“ gebracht, womit eine frühe Form von Rechtstaatlichkeit erreicht wurde. Herrschen und Beherrschtwerden wechselten sich in der Polis ab. Aristoteles:
„Wie nämlich der Mensch in seiner Vollendung das beste der Lebewesen ist, so ist er getrennt von Gesetz und Recht das schlechteste von allen. Die schwerste Ungerechtigkeit ist nämlich die, die über Waffen verfügt. … Doch die Gerechtig-keit bedeutet etwas Staatsbezogenes. Denn das Recht bedeutet die Ordnung der bürgerlichen Gemeinschaft; das Recht aber ist die Entscheidung über das Gerechte.“
Und heute?
Der prominente Rechtsphilosoph und Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde formulierte: „Der freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist.“
Böckenförde meinte damit, dass die Bürger in einer Demokratie die „moralische Substanz“ der Freiheit (Gleichberechtigung, Unantastbarkeit der Würde des Einzelnen usw.) verinnerlicht haben müssen, da das – alternative – autoritäre Gebot und der Rechtszwang (= absoluter Herrscher) die Freiheitlichkeit, schlimmstenfalls die Demokratie selber, aufheben würden. Die Corona-Pande-mie, unkontrollierte Massen-Zuwanderung, nachlassendes Vertrauen in das Sicherheits-Versprechen des Staates u.a., haben viele in Deutschland verun-sichert und das Land tief gespalten. In unserer repräsentativen Demokratie schwindet das Vertrauen in weite Teile der traditionellen politischen Klasse und der etablierten Medien. Ein Gefühl der Nicht-Repräsentation breitet sich aus. Erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg sitzt mit der AfD auch in Deutschland eine Partei des politisch rechten Spektrums in den Parlamenten. Die „moralische Substanz“ der Demokratie (Böckenförde) scheint zu erodieren.
Ist das so?
Die souveräne Macht des Demos.
Demokratie impliziert die souveräne Macht des Demos als verfassungsge-bende und rechtsetzende Gewalt (Demos = Staatsvolk). Die Macht des Demos ist also die Volkssouveränität. Die Demokratie (egal ob direkte oder repräsentative Demokratie) ist die Regierungsform, die dem Grundsatz der Identität der An-sichten von Regierten und Regierenden in einem permanenten Aushandlungs-Prozess zu entsprechen sucht. Die Bürger der Identität sind formal, rechtlich gleichgestellt.
Als primäre Identität nimmt sich die Bevölkerung selbst wahr – als ein konkretes Volk, eine politische Einheit, eine Gemeinschaft (als Polis), die sich wertschätzt. So schwer wie dies in einem Land wie Deutschland mit mehr als 80 Mio. Ein-wohnern – und trotz seiner föderalen Strukturen – mit der Realität in Überein-stimmung zu bringen ist.
Das allgemeine Wahlrecht ist eine Technik (neben anderen), mit der man herausfinden kann, was der Demos will.[3] Mit der man die Über-einstimmung (oder Uneinigkeit) zwischen Regierten und Regierenden, der einsetzenden und der eingesetzten Macht, überprüfen kann. Weichen beide stark voneinander ab, gefährdet das die demokratische („moralische“) Substanz.
Ein Bürger, eine Stimme …
Wer gehört zu den wahlberechtigten Bürgern, zum Volk? Unter dem Volk verstehe ich eine organische und gleichermaßen offene Einheit von Menschen mit erkennbaren Eigenschaften und Fähigkeiten – eine Gruppe (oder Gruppen) von Bürgern, die durch gemeinsame Geschichte, Kultur und Sitten miteinander verbunden sind – sicher kein biologisches Konstrukt, sondern eine konsensuale Erfahrungsgemeinschaft.
Die Lösung – Mehr Aristoteles wagen?
Die Grundlage einer konkreten Demokratie ist nicht die universelle Gleichheit aller Menschen, oder eine absolute Gleichheit, sondern die politische Gleichheit der Bürger in dieser Gesellschaft, in dieser Polis. Sie genießen die gleichen Rechte, weil alle gleichermaßen Bürger sind. Nichtbürgern die gleichen Rechte zuzugestehen, könnte sogar undemokratisch sein.
Auch ist der demokratische Raum ohne Grenzen nicht vorstellbar. Demokratie benötigt ein Territorium, in dem die Bürger, das Volk, leben. Das Aufblühen der Demokratien im 19. Jahrhundert ging mit den sich etablierenden National-staaten einher. Bereits in Griechenland war es die Stadt, die polis, die Demo-kratie ermöglichte. Demokratie ist an einen umgrenzten, erkennbaren Rahmen gebunden, auch wenn dies in bestimmten Konstellationen zu Unvereinbarkeiten mit universellen Menschenrechten führen kann.
Brauchen wir mehr „direkte Demokratie“, mehr unmittelbare Mitsprache des Demos?[4] Etwa zu Themen wie Zuwanderung nach Deutschland, der Energieversorgung oder der zu verwendenden Sprachformen (Stichwort Gendersprache)?
Brauchen wir (wieder) mehr „offene Rede“ der Bürger unter- und miteinander, etwa auch auf den digitalen Marktplätzen wie Facebook und Twitter (X)? Führt das zu neuer Annäherung an die moralische Substanz im demokratischen Gemeinwesen?
In der repräsentativen Demokratie müssen zumindest Unterschiede und Alternativen erkennbar sein. „Herrschen und Beherrschtwerden“ müssen in jeder Form von Demokratie wechseln können, damit sich Bürger, Wähler und Regierende näher kommen, sich ihrer Identität zuwenden können.
[1] Die Demokratien befinden sich auf dem Rückzug. Festgelegt wird dies im jährlichen Demokratie-index: Für die Erstellung des Demokratieindexes werden fünf Kategorien herangezogen, mit Punkten von eins bis zehn: Wahlverfahren und Pluralismus, Funktionsweise der Regierung, politische Beteiligung, politische Kultur und bürgerliche Freiheiten.
[2] Enzyklopädie Philosophie, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2010, Bd. 1, S. 366
[3] Alexis de Tocqueville (1805 bis 1859) warnte vor eine „Tyrannei der Mehrheit“ und befürchtete, dass die jeweilige Mehrheit zur „Sklavin der Leidenschaften“ werden könne und forderte u.a. „eine richterliche Gewalt, die von den anderen Gewalten unabhängig ist;“ (Über die Demokratie in Amerika, Reclam, 2020, 1835)
[4] Rousseau, Gesellschaftsvertrag, 3. Buch, I 5): In der repräsentativen, parlamentarischen Demokratie wird der Demos vom Akteur zum Wähler. Der Wähler ist aber nur am Tag der Wahl souverän. Wenn das Volk mit der Wahl „gesprochen hat“, so muss es danach schweigen.
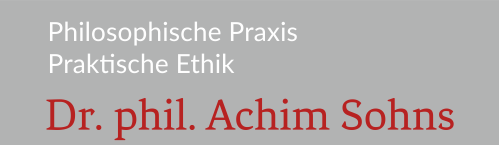
 Direkte Demokratie
Direkte Demokratie