Wie kam es zur Geldwerdung?
Die Erfindung des Geldes steht am zivilisatorischen Übergang vom Raub zum Tausch. Der Tausch absorbierte die Aneignung von Gütern durch Gewalt und: das Geld universalisierte diesen Tausch – als permanenten Handel zwischen Menschen, Unternehmen und in Gesellschaften.[1]
Nachdem in vormodernen Wirtschaftsformen der Substanzwert des Geldes, z. B. als Edelmetall – Gold, Silberlinge u.a. – wichtig war, erhält Geld seine Bedeutung zunehmend durch seine symbolische Funktion im Austausch, quasi als Mittler.[2]
Geld entwickelte sich: vom ungezeichneten Viehgeld (wieviel Ziegen für eine Braut?), ungemünztes Metall-Geld (Silberlinge) // über das vollwertige Münzgeld / respektive Papiergeld, also mit Wertaufdruck // zum heutigen Buch- oder Giralgeld (= Geld ohne physischen Gegenwert, als reiner, heute digitalisier-ter, schuldrechtlicher Anspruch).[3]
Was ist Geld ? Qu’est-ce que c’est la monnaie ?
Geld wird in dieser Entwicklung zum Symbol für alle Güter, für die es in Tausch gegeben werden kann – eine reine Abstraktion mit materieller Durchschlags-kraft. Käuflich wird so ziemlich alles. Alles, womit Geld in Kontakt kommt, lässt sich nun nach einem Wert, dem Geldwert, bestimmen, wird relativ zum Geld – ein Schmuckstück, ein Werkzeug, Lebensmittel oder Arbeitskraft – Alles wird in dieser Relation gebunden und verbunden, wird damit zugleich vergesellschaftet – in die Werte-Gemeinschaft der Tauschberechtigten. Wer kein Geld hat, ist nicht Teil der Gesellschaft und nimmt an der Entwicklung nicht teil. Gesellschaften, in denen Geld, die Geldwirtschaft, nicht funktioniert, bspw. wegen hoher Inflation, verlieren den inneren Kontakt, drohen zu zerfallen (siehe Argentinien).
Die Relationen des Geldes funktionieren also als innerer Zusammenhalt in der modernen Gesellschaft (siehe bspw. die D-Mark). Geld ist der Klebstoff, der nicht nur die Wirtschaft zusammen hält, sondern die Prozesse in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Sektoren verbindet und auf alle Sektoren aus-strahlt (eine Gesellschaft ohne Geld kann kaum Wohltätigkeit usw. finanzieren, droht an Zusammenhalt zu verlieren).
Die Geldwirtschaft ist selber ein Prozess, in dem sich das Geld aufgrund seiner ständigen Zirkulation einer eindeutigen Verortung entzieht. Anstelle absoluter Formen und Substanzen steht es für eine Welt der ewigen Veränderung alles Gegebenen, allen Seins. Alles ist im Fluss hatte Heraklit bereits vor 2500 Jahren gesagt. Es ist heute ein unumstößlicher Garant und ein Symbol der Moderne, für das Flüchtige, das Vergängliche.[4]
Das Geld, die Geldwirtschaft, bestimmt das Bewusstsein und das Denken der Menschen. Aber auch umgekehrt: was Geld, sein Wert ist, wird durch die Gesellschaft, die Menschen, bestimmt.
Geld ist für den Soziologen Georg Simmel Ausdruck der gegenseitigen Verbundenheit zwischen Menschen.[5] Er schreibt (in der Philosophie des Geldes 1908):
„Kurz, Geld ist Ausdruck und Mittel der Beziehung, des Aufeinanderangewiesenseins der Menschen, ihrer Relativität, die die Befriedigung der Wünsche des einen immer vom anderen wechselseitig abhängen lässt …“
- Kurz: Der geldwerte Wert von Dingen ist nicht objektiv, sondern durch subjektive Einschätzungen und soziale Prozesse entstanden. Die Menschen machen sich ihr Geld selber. [6]
Das Gelten des Geldes haftet lange nicht mehr an seiner materiellen Natur, eher scheint es sich um eine Art Geist, etwas Spirituelles zu handeln, das zu einer, wenn nicht der, materiellen gesellschaftlichen Macht geworden ist. Das Geld, damit auch der Geist, dringt in jeden noch so verborgenen Winkel des gesellschaftlichen Lebens. Die Menschen glauben an die Wertigkeit des Geldes. Es muss Geltung haben:
Das berühmte Zitat „Whatever it takes“ („Was auch immer nötig ist“) vom 26. Juli 2012 von Mario Draghi, dem damaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), während der Eurokrise meinte genau das: Mit der Aussage signalisierte er, dass die EZB alles tun werde, um den Glauben an das europäische Geld zu bewahren – was die Finanzmärkte unmittelbar beruhigte und eine Wende einleitete.
Wie wirkt Geld? Was macht es?
Alles steht mit allem durch Geld in Verbindung als ein Medium, das Denken, Handeln, Fühlen (Individualität, Persönlichkeit, Lebensstile) der Menschen beeinflusst.
- Das Unverbindliche, Offene, der Geldwirtschaft öffnet einerseits Handlungs- und Entscheidungs-spielräume, fördert also, so Simmel, die Freiheit des Individuums; Qualitative Unterschiede werden zu quantitativen – aus der Originalität von Produkten wird deren Geld-Preis, die Menge einer Währungseinheit, Rationalität.
- Gleichzeitig aber untergräbt das Geld traditionelle Werte, Hierarchien und persönliche Bindungen, weil es als Mittler zwischen die Menschen tritt. Auch zwischenmenschliche Beziehungen werden durch sachlich-nüchterne Austauschverhältnisse geprägt. Geldwirtschaft bedeutet auch immer Distanz, die relative Entwertung des Persönlichen: der Dresscode des Geld-Business ist stereoptyp …
[1] Die Evolution des Geldes stammt vermutlich aus dem sakralen Bereich: Schätzenswerte Dinge aus Privateigentum werden zu Tempelgaben, zu Geschenken und zu Tauschgegenständen.
[2] Geld scheint von seinen Ursprüngen her auf Ethik zu beziehen: Alte römische Münzen weisen das Bildnis der „Moneta“, der Münzgöttin, auf, die als Attribut eine Waage hält. Aristoteles vertritt die Auffassung, Geld habe seine Wertigkeit nicht von Natur aus, sondern durch den geltenden Gebrauch, weil „es in unserer Macht steht, dasselbe zu verändern und unbrauchbar zu machen.“ Nikomachische Ethik, V. 5, 11.
[3] Es wird unterschieden zwischen geldtheoretischem Nominalismus (= Geld kann „frei“ erzeugt werden; Gegen-stand von politischen Rechtsakten) und Realismus (Geld muss realen Substanzwert haben).
[4] Zur „Moderne“ biete ich Ihnen die Definition von Charles Baudelaire (1863): „Die Moderne ist das Vergängliche, das Flüchtige, das Zufällige, die eine Hälfte der Kunst, deren andere Hälfte das Ewige und Unwandelbare ist.“
Der Hunger bleibt, aber die Geschmäcker verändern sich.
[5] Es ist nicht möglich, etwa die neo-klassische Geldtheorie der Simmelschen Philosophie des Geldes gegenüberzustellen.
[6] „Das will besagen, daß die Erscheinungen von Wertung und Kauf, von Tausch und Tauschmittel, von Produktionsformen und Vermögenswerten, die die Nationalökonomie von einem Standpunkte aus betrachtet, hier von einem anderen aus betrachtet werden.(…) So ist, daß zwei Menschen ihre Produkte gegeneinander vertauschen, keineswegs nur eine nationalökonomische Tatsache; denn eine solche, d.h. eine, deren Inhalt mit ihrem nationalökonomischen Bilde erschöpft wäre, gibt es überhaupt nicht. Jener Tausch vielmehr kann ganz ebenso legitim als eine psychologische, als eine sittengeschichtliche, ja als eine ästhetische Tatsache behandelt werden.“ Simmel, Georg, Philosophie des Geldes, VII
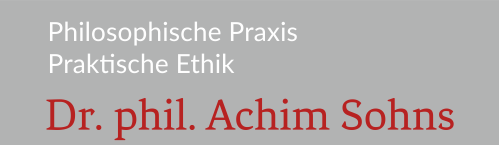
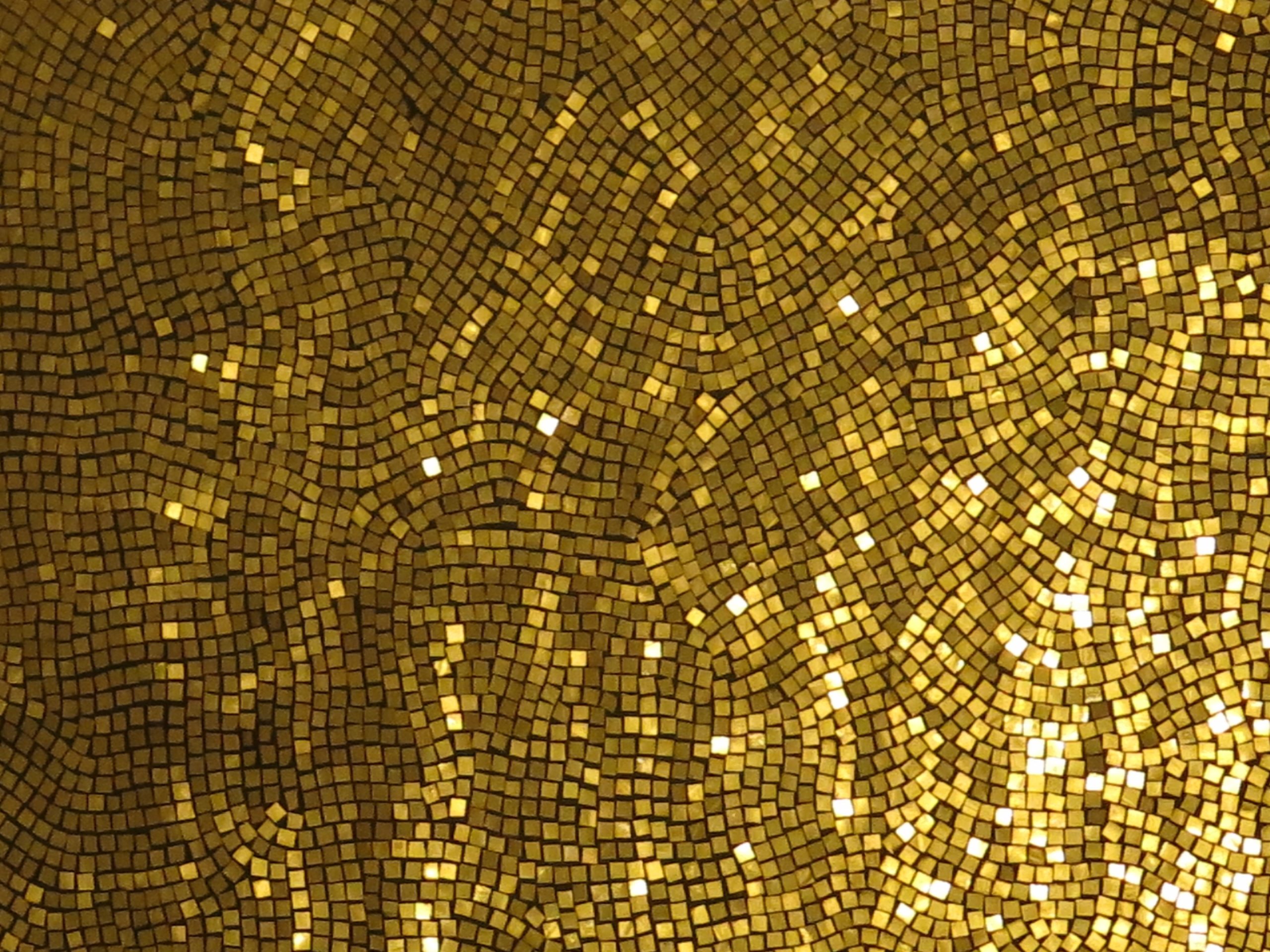 Gold
Gold